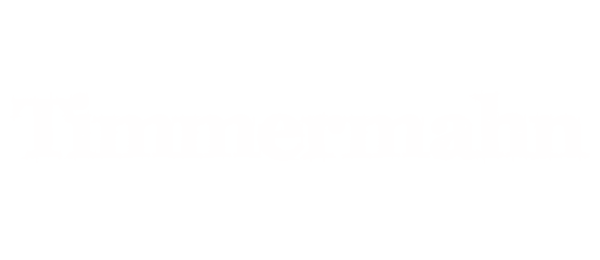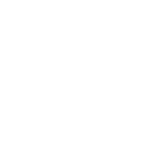LESUNG / Erzähler Timmermahn, musikalisch unterstützt von den bezaubernden Los Hobos, entführte sein Publikum im Schlachthaus Bern mit «Walterli und die Weissen Dichter» in ein Universum kurioser Geschichten.
reg. Der Meister betritt die Bühne, zerzaustes Haar guckt unter der Schirmmütze hervor. Er dankt höflich den Sponsoren und allen, die gekommen sind, und schwingt als nächstes den Taktstock. Die Timmermahn-Familie kennt das Ritual: «Es schneielet» erklingt im Schlachthaus. Der alte Mann setzt sich an den Tisch, knipst die Leselampe an, schlägt sein Ringheft auf und beginnt vorzulesen, oder vielmehr zu erzählen.
Die Buchstaben auf dem Papier erwachen zum Leben, wenn Timmermahn mit seiner markigen Stimme in stark berndeutsch gefärbter Schriftsprache seine behäbigen, zuweilen monumentalen Sätze spricht. Die Schwälle von Adjektiven, die der Fabulierer genüsslich ausbreitet, erinnern entfernt an Dürrenmatt; der bernische Singsang der Diktion trägt das Seine dazu bei. Und die krausen Wortschöpfungen und Lautmalereien lassen an Franz Hohler denken. Das Patchwork aber, das Timmermahn aus entfernten Assoziationen, winzigen Episödchen und versponnenen Träumereien zusammensetzt, ist etwas ganz eigenes.
Amerikanischer Traum
Sein neues Programm führt den hauptberuflich als Kunstmaler tätigen Timmermahn in das Land, wo alles ein wenig grösser ist, und in dem – jedenfalls in Timmermahns Kosmos – nichts unmöglich scheint. Da ereignet sich ein wundersamer Flugzeugabsturz, da steigt ein orgiastisches Rahmhüttenfest, da spazieren Zwergnonnen auf der Strasse. Und der kleine Walterli befindet sich inmitten all dieser sagenhaften Begebenheiten.
Der Bub ist ein literarisches Wunderkind, das schon mit drei Jahren in seinen Satiren die «Mittelständigkeit» der Gesellschaft monierte, und nicht viel später als junger Dichter in die Fussstapfen der Beat-Generation tritt. Wie Kerouac und die anderen Beatniks suchen Walterli und seine Eltern Rausch, Traum und Intensität.
Was Timmermahn um diesen Stamm einer Geschichte gruppiert, sind kuriose Äste: Keine Abschweifung, kein Schwenk der Erzählung ist ihm zu entlegen. Die Mär vom Stallknecht, der die Tochter seines Meisters mit einem Pferd verwechselt, ist nur eine davon. Dazwischen sinniert der Wortkünstler Timmermahn auch mal darüber, weshalb schlechte Dichter nicht zu schreiben aufhören können. Und kehrt dann dahin zurück, wo er aufgehört hat, oder auch nicht: Der 58-Jährige schert sich kaum um Kontinuität.
Was Timmermahns unkonventionelle und originelle Erzählweise ausmacht, entpuppt sich gleichzeitig als Gefahr: Das Ziellose schwächt den Fokus, und die Metaphern drohen zu entgleiten. Von Walterlis Berufung zum Dichter wird zwar erzählt, zu spüren ist sie jedoch kaum – die Faszination am literarischen Universum bleibt irgendwo im Geschichtenbaum verborgen.